Frau Grütters möchte auch aktiv sein, aktiv gegen Antisemitismus, speziell nach Halle und Hamburg. So las ich in einem Interview der Zeitschrift „Photonews“. Halle ist, wo man selbst an Jom Kippur den Schutz verweigerte und am letzten Jom Kippur den G’ttesdienst durch diverses, sagen wir, durcheinanderbrachte. Hamburg ist, wo man eine große Synagoge neu bauen möchte, um etwas gegen Antisemitismus zu tun. Oder um sich besser zu fühlen?
Wohl auch im allgemeinen Hype um 1700 Jahre (konstantinisch) belegtem jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands sieht man allerlei Aktionismus. Der „Beleg“ ist ein Edikt Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321, der zulässt, dass auch Juden zum Kölner Stadtrat zugelassen werden. Man sollte übrigens getrost davon ausgehen, dass der Zulassung zum Stadtrat noch ein paar Jahre vorher „jüdisches Leben“ erforderlich gewesen sind. Was soll man machen, ohne Tempelbau etc. ist das schwerlich archäologisch nachzuweisen.
Versuchte Konstantin noch 325 einen allgemeinen Religionsfrieden im Römischen Reich herbeizuführen, hört die „schöne heile Welt“ spätestens 380 mit dem Edikt Theodosius’ auf: Das Christentum wird zur Staatsreligion erklärt, Andersgläubige werden verfolgt, so sie nicht Christen werden. Persönlich bin ich gespannt, ob wir in neun Jahren 1.650 Jahre Christentum als herrschende Religion in Europa feiern dürfen.
Zurück zum Fotowettbewerb und meinem Versuch, meinen anfänglichen Zynismus zu zügeln. Der Wettbewerb ist, ganz ehrlich, Gedanke, der mich zunächst erfreute: Ich fotografiere (analog), ich habe einen Alltag, ich bin jüdisch. Passt doch. Doch dann, dann kamen diese Fragen. Ist es nicht doch wieder ein Ruf nach Bildern von Klischees? Sieht mein „Alltag“ nicht aus, wie jeder Durchschnittsalltag in diesem Land? Was wäre an meinen Fotos jüdisch? Ich denke darüber nach, was ich fotografieren würde. Es wären doch wieder Klischees. Der Schabbatleuchter, die Chanukkia, die ich vor dem nächsten Chanukka vom Wachs des letzten Jahres befreien sollte, oder die ziemlich eingestaubte Besamimdose, deren Gewürze so ziemlich nach nichts (mehr) riechen, oder mein Tallit, der schon lange nicht mehr ausgepackt wurde? Ach, die Siddurim wären da noch im Regal. Klischees, kein Alltag.
Alltag ist, der Kaffee am Morgen, dessen Packung die Schrift eines Bioladens trägt und gerade im Angebot war. Ok, da wäre noch die neue Küchenmaschine, mein erstes Werk waren Challot, die schneller verspeist war, als ich eine Kamera bereit hatte. Vielleicht wäre das ein Thema gewesen? Oder die Kernarbeitszeit des Öffentlichen Dienstes im Widerspruch zum Schabbatbeginn im Winter? Das Hetzen und wetzen, alles noch vor Sonnenuntergang hinzubekommen? Es klappt nie. Auch, wenn ich mich an vieles nicht halte, das für konservativere Jüd:innen wichtig ist, spielt es dennoch in meinen Alltag hinein. Sei es auch nur in Form des schlechten Gewissens. Schabbat ist eben Schabbat, ob nun orthodox oder liberal. Er ist das Besondere der Woche, das Andere, der Nicht-Alltag. Doch, was weiß der Öffentliche Dienst schon? Im Moment sind die größten Sorgen dort vor allem, wie man das sonst schon verkrampfte vorweihnachtliche Zusammensein jetzt digital hinbekommt.
Ich schweife ab. Was also ist jüdischer Alltag. Was stellt man sich in Grütters’schen Reihen darunter vor? Mein Sitzen vor meinem schon erwähnten Kaffee, der auf trinkbare Temperatur abkühlt, während ich mir die morgendlichen Zöpfe flechte? Vielleicht braucht es eher diese langweiligen, nicht erwarteten Bilder vom ganz normalen „jüdischen Alltag“, als die wohl doch wieder exotisierenden Abbildungen des Mannes im Tallit beim Morgengebet, der Schabbatisch, der nicht immer festlich wie ein Weihnachtsessen aussieht, sondern durchaus mal unaufgeräumt sein kann und dennoch mit den Insignien des Schabbats. Das heute schon omnipräsente Bild eines kippatragenden Hinterkopfes – ist das Alltag? Alltag für Jüdinnnen und Juden, vielleicht. Alltag aber auch wie die Hochsicherheitseinrichtungen, die wir Schulen und Synagogen nennen, Alltag wie die immer präsente Gewissheit, dass das Gebet, das wir in unseren Versammlungshäusern beten, unser letztes sein kann, Alltag auch wie der Gedanken von Eltern, wie sie ihre Kinder schützen können, vor dem Unvermeidlichen. Gedanken und Gefühle, die man schwer abbilden kann. Die da sind. Alltag sind. Nicht sichtbar und oft genug unbesprochen. Vielleicht gibt es Fotograf:innen, die das abbilden können. Ich kann es nicht.
Was hingegen gesehen zu oft werden will, sind die romantischen Bilder, einer (vergangenen) Welt, so scheint mir, oder eben der Welt, die hier nicht möglich ist.
Der Wettbewerb, dessen Sieger:in 5.000 € erhält, ist eine einfache Idee, fast schon wieder eine Verzweiflungsreaktion, wie mir scheint. „Man muss doch etwas tun.“ Wieder soll gezeigt werden, wie normal doch alles ist, was es nicht ist. Vielleicht nur ein Gedanke: Wäre es besser gewesen, genau das Gegenteil zu fordern. Nicht Bilder des „intakten Alltags“, sondern Bilder, die genau das Gegenteil zeigen? Die Waffen, Mauern, Stacheldraht, die jüdisches Leben möglich machen, den Hass im Gesicht und in den Stimmen von Menschen, die zwar keinen jüdischen Menschen kennen, aber zu wissen glauben, dass alles Negative sich dort zentriert. Die abgeblendeten Scheiben eines jüdischen Gemeindehauses, das einst für Offenheit entworfen wurde und das so nicht der „safe space“ wurde, der er sein sollte. Stattdessen von Kameras umzäunt, mit Metalldetektoren im Eingang. Jüdinnen und Juden sind oft so sehr daran gewöhnt, kannten es nie anders, dass es von der einen oder dem anderen als normal angesehen wird. Doch das ist es nicht. Es ist die Illusion eines jüdischen Lebens, wie es nicht sein sollte, es aber ist und sein muss. Auch das ist die Folge eines Ediktes von 380. Solange Antisemitismus und jeder Rassismus nicht angegangen wird, außer in immergleichen Sonntagsreden, sind auch Fotowettbewerbe Akte der Hilflosigkeit. Dennoch, vielleicht reiche ich es etwas ein. Wenn auch, um nur ein Zeichen zu setzen. „Nicht das, was Sie erwarten“, war einmal der Slogan des Jüdischen Museums Berlin. „Nicht das, was Sie erwarten“ für Frau Grütters neueste Idee. Vielleicht sollte ich das tun.
Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es unter fotowettbewerb-jüdischer-alltag.de. Bilder können bis zum 20. Dezember 2020 eingereicht werden. Ich gehe derweil in die Dunkelkammer.

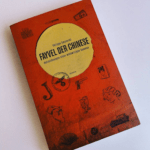


Schreibe einen Kommentar