Ausstellung
Es wird versucht, Luthers Sichten und Urteile zu erklären, die Lebenswelt und Realitäten. Warum kam Luther zum Schluss, dass Juden wegen ihres Unglaubens ausgetrieben gehören und welche Folgen hatte das bereits in seiner Zeit und kurz danach?
Juden zur Bachzeit „Das gemeine Judenvolk“
Kannte Bach überhaupt Juden? Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Er stützt sich auf die Autorität Luther mit seinen Schriften. Wie sah das Leben der Juden in Bachs Zeit aus? Die „Messejuden“ in Leipzig, die bestimmten restriktiven Auflagen unterlagen, wie alle Juden, so sie siedeln durften.
Bachs Bibliothek „Des jüdischen Volks Unglauben, Blindheit und Verstockung“
Woraus bezog Bach sein Wissen, seinen Glauben als strenger Lutheraner? Natürlich Bücher, primär Luthers Schriften. Wir gewinnen einen Eindruck, in welchem Glauben Bach aufwuchs. Zu beachten besonders, dass man im Bachhaus versucht, Bachs Bibliothek wieder zusammenzustellen. Nicht anders kann man Bachs Gedanken- und Lebenswelt versuchen zu verstehen.
War Bach tatsächlich Antijudaist oder folgte er dem vermeintlichen Wissen, das durch Luthers Schriften Bachs Welt und Zeit bestimmte, der Juden zwar nicht mehr als die Mörder Jesu verurteilte, sondern als die verstockten Menschen sah, die nicht zum „rechten Glauben“ fanden, wie Luther es gern wollte. Wären die Auswirkungen nicht so dramatisch über die Jahrhunderte, wäre es doch geradezu lächerlich. Gelegentlich sehe ich vor innerem Auge, einen vor trotziger Wut aufstampfenden Luther, der seinen Willen nicht bekam. In diesem Geiste also, mit dem Glauben, dass Juden durch ihren Unglauben unrettbar seien und damit auszutilgen lebte auch Bach.
Wir verlassen Raum eins, noch die Musik im Ohr, die in einzelnen Stationen die Schrifttafeln und Bücher in den Vitrinen begleitet.
Eine Etage höher sehen wir schon am Schriftbild, dass sich die Zeiten ändern. Ging es im Teil eins noch um Grundlagen, so spielen hier Personen die Hauptrolle.
Die Ausstellung geht der Frage nach der Wiederentdeckung der Musik des durchaus vergessenen Bachs nach. So war es Felix Mendelssohn Bartholdy, der die Passion 1829 in der Singakademie (heute Gorki Theater) wieder aufführte und nicht nur am Premierenabend fast überrannt wurde, sondern einen regelrechten Bachboom auslöste:
Außenseiter entdecken Bach „Sphärenklang im Staube“
Die Musikästhetik Kirnbergers unter Mitwirkung Moses Mendelssohns mit Bach als Ideal. Die Kinder und Enkel Mendelssohns wurden vielleicht dadurch so tief geprägt. Wir sehen Porträts, Biographien und Beweggründe der Verehrung Bachs bzw. seiner Musik, so von Moses Mendelssohn, Isaac Itzig und seine Töchter Sara, Fanny, Zippora, Hanna und Bella, Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel, Ignaz Moscheles, Joseph Joachim. Menschen, Juden, ohne die Bachs Passion womöglich vergessen wären.
Die Frage wird gestellt, wieso gerade die Juden? Selbst Felix Mendelssohn-Bartholdy scheint es nicht ganz beantworten zu können und so ist von der (verwundert amüsierte?) Ausspruch überliefert:
„Ein Judenbengel und ein Komödiant haben dem deutschen Volke die Matthäus-Passion wieder geschenkt.“
Eine kurze Geschichte der Wiederentdeckung findet man übrigens im sehr unterhaltsamen Film „Als wie ein Lamm“ – Die Matthäus-Passion, der wie die Ausstellung selbst auf Deutsch, Englisch, aber auch Ivrith verfügbar ist. Nicht mehr ganz dem Forschungsstand entsprechend, dieser wird aber in der Ausstellung korrigiert. Der Film, ursprünglich für die Jerusalemer Ausstellung über Bachs Matthäus-Passion von den „Buchstabenschubsern“ produziert, bringt der Ausstellung die nötige Leichtigkeit. Mit freundlicher Genehmigung des Bachhauses hier auch zu sehen:
Was wie eine eindeutige chronologische Schau erscheint, wird unterbrochen durch Rezeptionen im Nationalsozialismus. So zum Beispiel der Hinweis auf das „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“ das sich eben hier und nicht ohne Grund in Eisenach befand. Wir finden eine Reihe von Heften, mit dem die Vertreibung der Juden historisch begründet werden sollte – Grundlage: Luther. Ein Blatt des Stürmers, der die durch Luther wiederholte Lüge vom Ritualmord – die uns bis heute begleitet. Hansen versucht, Zusammenhänge aufzuzeigen, zum Nachdenken anzuregen. Auch hier werden wir von Musikbeispielen begleitet. (Mein Favorit übrigens Concerto D Minor, BWV 105,2 (eigentlich für Streicher) von Ling-Ju Lai, auch ganz pur am Klavier funktioniert. Bachverehrer mögen mich dafür verurteilen.)
Fazit:
Die Eisenacher Ausstellung wird, wie es aussieht eine Ausnahme sein. Die großen Lutherausstellungen im kommenden Jahr werden das ungeliebte Thema Antijudaismus aussparen, nicht nur deshalb sollte dieser Ausstellungssolitär schon fast Pflichtprogramm sein. Der Bogen zwischen Luther, Bach und Neurezeption gelang.
Impressionen:
Ich durfte die Reise auf freundliche Einladung von ARTEFAKT Kulturkonzepte Berlin unternehmen. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür.














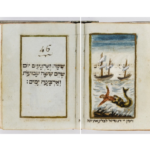
Schreibe einen Kommentar