„Du bist ja keine richtige Jüdin, wenn Du da hingehst.“ so hörte ich noch Anfang der 2000er Jahre, weil ich die Synagoge Oranienburger Straße besuchte. Dort leiteten Frauen den G’ttesdienst. Was heute fest über die Berliner Gemeinde etabliert ist: eine amtierende Rabbinerin und eine Kantorin, war damals und ist für viele auch heute noch undenkbar. Erlebnisse wie diese waren unter anderem der Auslöser diesen Blog zu beginnen.
Hat sich seit dem etwas geändert? Gesa Ederberg ist offizielle Gemeinderabbinerin und auch Avitall Gerstetter ist regulär von der Gemeinde eingestellt. Dem voraus gegangen war eine Initiative von Frauen, die etwas suchten, was sie in den sehr konservativ geprägten jüdischen Nachkriegsgemeinden nicht fanden. Diese Zeit des, uns sie mögen es mir verzeihen, dass ich es so bezeichne, Experimentierens war der Grund, warum ich mich entschloss (wieder) jüdisch zu leben. Heute sehen die G’ttensdienste in der Oranienburger Straße anders aus, geblieben ist vielleicht doch etwas weiblicher Geist.
Ich verließ Deutschland und erlebte anderes jüdisches Leben. Leben, von dem wir bis heute weit entfernt scheinen. Die Vielfalt jüdischen Lebens, sie gliedert sich in unserem Land vornehmlich in orthodox und noch immer liberalen Gemeinden in der Minderheit, zum Großteil bis heute nicht anerkannt und entsprechend schlecht mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Braucht oder sucht man jüdische Infrastrukturen muss man sich zwangsläufig an die etablierten Gemeinden halten. Es ist ein Teufelskreis. Manchmal, wie eben in Berlin, sieht es etwas anders aus. Hier ist nach außen Vielfalt möglich. Offiziell gibt es acht Synagogen, dazu fünf angestellte Rabbiner, eine Rabbinerin, sechs Kantoren, eine Kantorin.
Eine Deutsche Rabbinerkonferenz mit Mitgliedern aller Ausrichtungen wurde 2004 gegründet. Man findet dazu keine Informationen mehr. Zwei Konferenzen arbeiten parallel, so die Orthodoxe Rabbinerkonferenz in der naturgemäß nur Männer anzutreffen sind: 58 Mitglieder und die Allgemeine Rabbinerkonferenz: 29 Mitglieder, darunter immerhin sechs Frauen. Natürlich gibt es mehr Rabbinerinnen und Rabbiner im Land, allerdings nicht in diesen Organisationen.
Statistik aufzuzeigen aber ist nicht Grund dieses Textes. Es sind persönliche Geschichten, die ich zur Frage, der Rabbinerin erlebe. Eine Frage, die sich mir nicht stellt. Die mich doch aber immer wieder erstaunt. Wie sehr haben wir unsere eigene Geschichte vergessen? Wie viel unserer Geschichte wurde durch die Shoa zerstört und wieviel lassen wir nicht mehr leben?
Es war einer der wenigen Streits, den wir hatten. Ich verstand nicht, wieso man eine Rabbinerin in der Gemeinde nicht anerkennen würde. Was war anders, nur weil sie eine Frau war? Sie hatte die selbe Ausbildung durchlaufen, wie ihre männlichen Kollegen. Wir waren nicht orthodox. Wir waren ein paar, das auf unterschiedlichen Kontinenten aufwuchs, beide aber jüdisch liberal. Der Streit ging mir an die Nieren. „Ich kann das nicht. Ich kann keine Frau in diesem Amt ernst nehmen.“ Mein Warum fand keine Antwort. „Kannst Du mich ernst nehmen?“ Es war für mich eine zentrale Frage in dieser Beziehung, wie wir jüdisch leben würden. Jüdisch sein allein reicht nicht. Man sollte und muss Ansichten teilen. Der getrennte Synagogenbesuch ist nicht das Ideal, um es gelinde zu sagen. Ich verstand es nicht, es trieb mich herum. Für mich zählt, der Mensch, komme ich gut mit der Person zu recht. Gefällt mir, was sie sagt, gefällt mir, wie die Person unterrichtet, wie sie mit Menschen umgeht. Es ist mir egal, wie ihre Geschlechtsteile aussehen. Zurück in Berlin ging ich zu meinem Rabbiner. Ich brauchte Rat, fühlte mich hilflos. Etwas war ins Mark getroffen, doch ich dachte, dass ich es umgehen, ignorieren kann. „Das kannst Du nicht. Es ist eine zentrale Frage, eine Frage auch, wie man Menschen sieht und wie Ihr Kinder erziehen wollt, wenn Ihr welche bekämt.“ Ja, es ist eine zentrale Frage. Ein paar Jahre danach trennte ich mich. Nicht aus diesem Grund. Das Erlebnis lehrte mich aber auf Dauer, dass das „jüdisch sein“ bei weitem nicht ausreichen kann, um eine Beziehung zu führen.
Ich erinnere mich noch immer an meinen letzten G’ttesdienst in den USA, bevor ich für immer nach Deutschland zurückkehrte. Ich mochte die Gemeinde sehr. Eine Rabbinerin und zwei Rabbiner leiteten an diesem Abend. Es gab den Gijur einer jungen Frau zu feiern, am Morgen wurde das Meer für sie zur Mikwe. Es war ein schöner Abend, vielleicht der schönste Schabbatabend, den ich erlebte.
Es war eine Selbstverständlichkeit, eine Unhinterfragtheit, die ich hier wenig kenne. Zu oft und immer wieder ein „Das könnte ich nicht. Eine Frau als Rabbinerin. Das geht nicht. Das kann ich nicht ernst nehmen.“ Noch immer frage ich warum? Noch immer frage ich: „Kennen Sie denn eine? Waren Sie schon einmal in einem weiblich geführten G’ttestdienst? Was ist dort anders?“ Die Befragten waren es nie. Sie haben ihr Urteil bereits gefällt, sie bleiben in ihrem „Ich kenne es nicht anders, ein Rabbiner muss männlich sein.“ Kann ich es verstehen? Die Angst vor dem Unbekannten? Was ist anders? Ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, dass man sich mit „seinem“ Rabbiner wohlfühlt. Doch was ist, wenn man umzieht? Wenn die Person, zu der man die Bindung hat, eben doch nicht mehr da ist?
Es bleibt mein Eindruck, dass eine Rabbinerin im Land der ersten Rabbinerin Regina Jonas leider noch immer und lange eine Ausnahme ist, trotz der Ordinierungen des Geiger Kollegs. Die Mehrheit der deutschen Gemeinden sind orthodox. Es hat seine Gründe, seine Geschichte. Und doch hätte ich mir von der Neuerweckung des liberalen Judentums in Deutschland ab der 2000er Jahre mehr erhofft, erhofft auch mehr an deutlicher Unterstützung durch den Zentralrat und mehr Zugewandtheit statt Konkurrenzdenken der etablierten (orthodoxen) Gemeinden. Es geht auch zusammen, auf Augenhöhe. Man muss es nur wollen.
Und die Gegenfrage? Wie gehst Du mit orthodoxen Rabbinern um? Nun, so, wie ich mit allen Menschen umgehe. Ich mag nicht immer einer Meinung sein. Meine Interpretationen sind und dürfen andere sein. Doch ich achte sie, wie ich auch erwarte geachtet und respektiert zu werden. Allerdings hört es auf, wenn Urteile gefällt werden, wenn von oben herab geschaut wird. Das aber hat wieder mit der Persönlichkeit zu tun. Ich lese sehr gern den Blog von Rabbi Folger und eine Woche ohne den Podcast von Rabbi Lord Sacks ist eine verlorene Woche für mich. Warum auch sollte eine liberale Jüdin nicht inspiriert durch die Worte orthodoxer Rabbiner sein? Letztlich bei allein Differenzen, sind wir noch immer eine Familie. Und in Familien streitet man sich. Gegenseitige Achtung gilt für alle Menschen, sie sollte gelten. Manchmal müssen wir uns einfach mehr daran erinnern. Und vielleicht versuchen Sie es mal. Gehen Sie zum Schabbat doch mal in Berlin, in Frankfurt, Bamberg, Freiburg, Hameln, Oberhausen, Unna, Oldenburg oder Delmenhorst in die Synagoge. Dort nämlich könnten Sie auf Rabbinerinnen treffen. Und dann, dann reden wir nochmal über das „Das geht gar nicht“. Es geht vielleicht eben doch. Und wenn es Ihnen doch nicht gefällt, wird es nicht allein am Geschlecht der Person auf der Bima liegen. So hoffe ich.
Empfehlung zur Geschichte der ersten Rabbinerin in Deutschland: Rabbinerin Elisa Klapheck (Hrsg.): Fräulein Rabbiner Jonas. Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? ISBN: 978-3-933471-17-8
Zur Änderung in der Orthodoxie, in der inzwischen auch Frauen ausgebildet werden, allerdings nicht Rabbi genannt werden dürfen, der Podcast mit Leah Sarna auf Unorthodox oder ein älterer Artikel zur Yeshiva Maharat
Foto: Offenbacherjung , via Wikimedia Commons


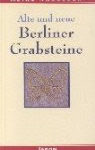

Schreibe einen Kommentar