Fast ohne viel Brimborium, fast ohne besoffen übergeschnappte Medienwelten eröffnete am 4. März 2017 der Pierre-Boulez-Saal in der Französischen Straße in Berlin, die Rückseite der Staatsoper (unter den Linden). Noch in der Eröffnungswoche wollte es der Zufall, dass ich selbst unerwartet Gast sein durfte. Ein erster Eindruck.
Der Eingang zum Boulez-Saal, es gibt wohl noch keinen Spitznamen, befindet sich ganz unprätentiös auf der Französischen Straße, die an dieser Stelle versucht, sich wieder Leben einzuhauchen. Der Saal wurde in den vergangenen Jahren im ehemaligen Magazingebäude der Staatsoper untergebracht. Die alten, fabrikartigen Türen blieben. Auch sonst ist der Eingangsbereich alles andere als pompös. Schlichte Räume, die auf das Wesentliche konzentrieren. Hier und da etwas Kunst, ein paar Zitate an den Treppen, ein paar Bildschirme, auf denen Mitschnitte anderer Konzerte laufen. Es ist, ebenso nüchtern betrachtet, letztlich der Konzertraum der Barenboim-Said-Akademie.
Das Boulez-Ensemble gab unter Daniel Barenboims Leitung Boulez. Was auch sonst? Schließlich ist Saal und Ensemble nach ihm benannt. Eine kleine Erziehungsmaßnahme des Meisters Barenboim für das sonst traditionelle Berliner Publikum? Keine Frage, Boulez ist nicht für jedermann. Und dennoch, die Maßnahme wirkte bei mir. Die Begeisterung der Musiker selbst übertrug sich. Man ist mit ihnen. In der Musik. Im Raum. Der intimen Atmosphäre des kleinen Saals kann sich wohl kaum jemand entziehen. In den überaus bequemen Sitzen bleibt nur das Wesentliche: Raum zu fühlen, die Augen zu schließen und alles zu vergessen. Nichts lenkt ab. Die Instrumente selbst nicht nicht nur kleine Punkte am Menschen. Man kann ihre Narben sehen, ihre Geschichte, ihre Eigentümlichkeiten, wie sie eins werden mit ihrem Musiker.
Meine Befürchtung, dass die Akustik ebenso genau ist, dass man alles im Saal hört, wie es aus der Hamburger Philharmonie berichtet wird, bestätigte sich zum Glück nicht.
Pause. Klang in den Ohren. Glückliche Gesichter der Musiker und des Publikums. Tosender Applaus. Etwas frische Luft auf der stillen Straße. Nur der Bus kreuzt hier dann und wann, eine einsame Radfahrerin, die dem Trubel und Baustelle auf den Linden zu entkommen versucht.
Der zweite Teil des Abends brachte Mozart. Gewöhnlich, gewohnt, nach dem um soviel energiereicheren Boulez. Ein etwas anderes Ensemble in anderer Richtung gesetzt. Barenboim dirigiert frei und ohne Podest. Ein wirkliches Kammerkonzert. Entspannte Atmosphäre. Allerdings auch weniger bemerkenswert als der erste Teil.
Dennoch gibt es ein paar Dinge, über die ich mir Gedanken machte, als ich den Blick schweifen ließ:
Kinder. An diesem einen Abend sah ich zwei Kinder. Nun mag es daran liegen, dass es ein Schultag war. Doch sind die Zahlen sonst auch nicht besser. Es gibt kaum noch Kinder in Konzerten. Woran liegt das? Woher kommt die Scheu? Wurde den Eltern der Besuch vergällt und wollen sie es nicht weitergeben? Ist es zu teuer? Ist der Abstand zur klassischen Musik so groß geworden, dass man Kindern den Zugang nicht mehr über den leichtesten aller Wege gewährt: den Konzertbesuch?
Ich kann es nicht beantworten. Ich wurde von klein auf in Konzerte mitgenommen. Es war normal. Kein Ereignis. Eine wunderbare Normalität, die ich heute noch mehr zu schätzen weiß, da ich immer mehr sehe, welch großes Geschenk es war.
Im Boulez-Saal versucht man der Scheu entgegenzuwirken. Besucher unter 30 Jahren bezahlen 15 Euro, Familien zahlen für Kinder bis 19 Jahre 50%. Es gibt ein spezielles Youthprogramm. Alle Ermäßigungen findet man hier.
Diversität. Die Ensemble waren überaus divers. Denn in der Musik spielen Herkunft und Geschlecht keine Rolle. Nur die Musik zählt, der Mensch ist zurückgenommen. Allerdings im Publikum sah man nur Besucher mitteleuropäischer Herkunft, ein asiatisches Pärchen noch. Das war es. Eine junge Frau mit Hijab begegnete mir nach dem Konzert. Sie gehörte zu einem der Musiker. Im Publikum vermisste ich das. Was kann man tun, dass nicht nur der Biodeutsche mit entsprechendem Hintergrund den Weg hier hin findet? Gerade hier, wo eben all das, was so vielen so wichtig und zentral in diesen Tagen erscheint, so unwichtig ist. Ist nicht Musik eine Sprache, die alle sprechen? Die Sprache der Verständigung ohne Übersetzung, Erklärung? Es machte mich etwas traurig. Gerade dort an diesem Ort, hätte ich auf weniger Hürden gehofft, und hoffe weiter. Schaue ich allerdings auf die Schulbildung in Sachen Künste und die immer wieder stattfindenden Einschnitte in diesen Fächern, bin ich pessimistisch. Nein, Kunst und Musik sind keine Themen vermeintlicher Eliten. Sie gehören jedem und jeder sollte ohne Hemmnisse teilhaben können. Es bleibt noch zu tun. Viel zu tun.
Und ja, auch mit wenig Geld kann man ins Konzert. Berlin-Pass Inhaber können ab 30 Minuten vor Einlass noch Karten für 3 Euro erhalten. Es ist ein Risiko, ob man noch eine Karte bekommt, sicher, aber es lohnt sich. Versprochen.
Abläufe. Das Haus ist neu und vieles muss sich einspielen. Gehe ich mit dem professionellen Blick hinein, so sehe ich ein paar Fehlplanungen. Das Personal ist überaus freundlich und hilfsbereit – nur an den falschen Stellen. Beim Einlass ist nur eine Person pro Tür positioniert. In einem neuen Haus fatal, müssen sich hier noch mehr Menschen zurecht finden.
Die Garderobe ist zu klein geplant. Möchte man erreichen, dass die Besucher ihre Jacken und Gepäck nicht mit in den Saal nehmen, in London z.B. ist das mehr und mehr zu beobachten, muss hier nachgebessert werden. Das wird aus Platzmangel sehr schwierig. Ich selbst war vor dem Konzert den ganzen Tag unterwegs und hatte zumindest einen gut gefüllten Rucksack dabei. Ich war nicht die einzige. Es wurde schwierig. Nach Konzertende dauerte es gut eine Stunde bis man seine Sachen bekam. Zum Glück wurden hier dann statt der anfangs zwei, vier Mitarbeiter eingesetzt. Allerdings müssen sich auch hier noch Abläufe einspielen.
Gut, mehr als nötig, besetzt ist die Bar. man findet sich zur Seite des Saals. Räume zum Sitzen und etwas Ruhe finden allerdings auf der anderen Seite der zentralen Treppe. Hier ist zwar auch noch eine kleine Bar, die allerdings ist so versteckt, dass man es wissen muss. Außerdem wird sie von der Schlange zur Garderobe zugestellt.
Man sollte allerdings vom Angebot Gebrauch machen, in der näheren Umgebung sieht es mau aus.
Fazit:
Der Pierre-Boulez-Saal ist ein Gewinn für die Stadt. Das Angebot umfasst ganz klassische Konzerte, Liederabendende, aber auch Jazz, Musik aus Persien, arabische zeitgenössische Musik, neue Musik, Klarinettenkonzerte. Es gibt keinen Grund, nicht einen Besuch zu wagen. Und nein, man muss nicht nur gehen, wenn Meister Barenboim selbst anwesend ist. Das wäre absurd.
Für mich war es nicht der letzte Besuch. Gleich in der ersten Aprilwoche darf ich wieder gehen und auch das wird nicht das letzte Mal sein. Auch für Konzertsäle zählt: man sollte sich wohl fühlen. Das tue ich dort. Es ist kein Ort zum sehen und gesehen werden. Es ist ein Ort, an dem nur eines zählt: die Musik.
Danke für dieses Geschenk!
Foto von Fridolin freudenfett – Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0, Link



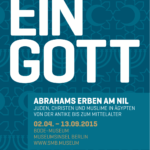
Schreibe einen Kommentar